 Martin Antretter
Martin Antretter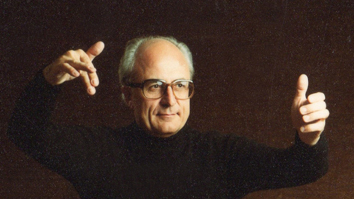 Günther Andergassen
Prof. Dr. Günther Andergassen (17.4.1930 - 19.1.2016) - war eine markante Musikerpersönlichkeit (Komponist, Chorleiter,
Musikpädagoge), die vielen Musiklehrern in Tirol als universell gebildeter (Romanistik, Anglistik, Kunstgeschichte,
Philosophie, Musikwissenschaft) und engagiert und vielseitig Unterrichtender am Tiroler Landeskonservatorium in Erinnerung
ist. Er war der wesentliche Motor für den Aufbau der modernen Musiklehrer-Ausbildung (Instrumental-und Gesangspädagogik IGP);
zahlreiche Preise und Ehrungen würdigen sein Schaffen. Als Komponist hinterlässt er uns Zitherspielern zwei richtungsweisende
Werke, den »Zyklus für Zither« (Preissler-Verlag), ein höchst anspruchsvolles, akribisch durchgearbeitetes Stück,
und den »Jahreskreis«, 14 Lieder auf japanische Haikugedichte für Sopran und Zither (Psalteria-Verlag), ein
atmosphärisch-dichtes, in Naturmystik ruhendes und atmendes Werk.
Anlässlich des Requiems für Prof.Dr. Günther Andergassen hielt Dr. Nikolaus Duregger, Direktor des Tiroler
Landeskonservatoriums, folgende Ansprache:
Günther Andergassen
Prof. Dr. Günther Andergassen (17.4.1930 - 19.1.2016) - war eine markante Musikerpersönlichkeit (Komponist, Chorleiter,
Musikpädagoge), die vielen Musiklehrern in Tirol als universell gebildeter (Romanistik, Anglistik, Kunstgeschichte,
Philosophie, Musikwissenschaft) und engagiert und vielseitig Unterrichtender am Tiroler Landeskonservatorium in Erinnerung
ist. Er war der wesentliche Motor für den Aufbau der modernen Musiklehrer-Ausbildung (Instrumental-und Gesangspädagogik IGP);
zahlreiche Preise und Ehrungen würdigen sein Schaffen. Als Komponist hinterlässt er uns Zitherspielern zwei richtungsweisende
Werke, den »Zyklus für Zither« (Preissler-Verlag), ein höchst anspruchsvolles, akribisch durchgearbeitetes Stück,
und den »Jahreskreis«, 14 Lieder auf japanische Haikugedichte für Sopran und Zither (Psalteria-Verlag), ein
atmosphärisch-dichtes, in Naturmystik ruhendes und atmendes Werk.
Anlässlich des Requiems für Prof.Dr. Günther Andergassen hielt Dr. Nikolaus Duregger, Direktor des Tiroler
Landeskonservatoriums, folgende Ansprache: Martin Antretter
Martin Antretter |
 Salvenberg Trio
Salvenberg Trio |
 |
Weint um mich, doch nur mit Freudentränen, denn ich will euch fröhlich einst begegnen. Weiße Rosen soll es reichlich regnen auf verborgne Teiche und Fontänen. (Roland Jordan, November 2019) |
 Norbert Leutschacher (1941-2019)
Norbert Leutschacher (1941-2019) Anny Loibl
Anny Loibl |
 Franz Loibl
Franz Loibl |
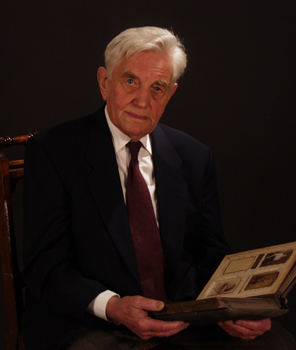 Adolf Meinel
Am 25. Mai 2009 verstarb im Alter von fast 99 Jahren einer der bekanntesten Zithernbauer, der Nestor der
Markneukirchener Instrumentenbauer, Adolf Meinel.
Adolf Meinel wurde am 30. Oktober 1910 in Markneukirchen als Sohn von Adolf Friedrich Meinel (1872 1953)
geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit absolviert er zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend erlernte
er in der traditionsreichen elterlichen Instrumentenbauwerkstätte den Beruf des Zitherbauers und legte 1929 die
Gesellenprüfung mit Auszeichnung ab. Im Jahre 1936 bestand er auch die Meisterprüfung als Zupfinstrumentenbauer.
Wahrscheinlich hätte es für Adolf Meinel nie etwas anderes gegeben als diesen Beruf. »Ich war gut in der
Schule, aber ich wollte arbeiten, in der Werkstatt Instrumente bauen. Zitherbauer ist kein Beruf, dazu muss man geboren
sein. In den Instrumenten steckt eine Seele, die man ihnen gibt.« Der Arbeitsalltag des Instrumentenbauers begann
schon früh: Morgens um 4.30 Uhr aufstehen, die Werkstatt heizen, alles für sich und die Gesellen vorbereiten, um
pünktlich um 6.00 Uhr mit der Arbeit beginnen zu können
Adolf Meinel fertigte in dritter Generation des bereits von seinem Großvater im Jahre 1862 gegründeten Betriebes
Zithern und Gitarren, die in der ganzen Welt hohe Anerkennung fanden. In enger Zusammenarbeit mit seinem Vater wurde
die Klangqualität der Meinel-Zithern auf ein außerordentliches Niveau angehoben. Zusätzlich befasste sich Adolf Meinel
aber auch mit der Weiterentwicklung der Saiten. Er erprobte und berechnete die günstigsten physikalischen Zusammenhänge
zwischen der Mensur, der Saitenspannung, dem Saitenkern und der Umspinnung der Saiten, um eine optimale Klangqualität
auch im Bereich der Saiten zu gewährleisten.
In den 30er Jahren interessierte sich Adolf Meinel in besonderem Maße für die Entwicklung der Quint- und
Basszither. Dadurch war es möglich, auch die Zitherspieler wie in einem klassischen Quartett mit Quint-, Diskant-,
Alt- und Basszither gemeinsam musizieren zu lassen. Was nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass Adolf Meinel eine
Zeitlang auch Zither- und Gitarrenunterricht erhalten hat, und zwar von dem Zithervirtuosen Ernst Rommel, Lehrer
für Zither an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar.
Seit etwa 1930 beschäftigte sich Adolf Meinel zunächst mehr aus persönlichen Gründen mit dem Bau von
Gitarren. Daraus entwickelte sich dann ein zweiter Geschäftsbereich. Diese Entwicklung sollte sich später als sehr
nützlich erweisen, half sie doch mit, während der DDR-Zeit den Fortbestand der traditionsreichen
Instrumentenbauwerkstätte zu sichern. Adolf Meinel äußerte sich folgendermaßen dazu: »
ich habe durch den Bau
beider Instrumente Einblicke gewonnen, die ich als Nur-Zitherbauer oder als Nur-Gitarrenbauer niemals hätte erwerben
können
«.
Die Werkstatt Adolf Meinel war besonders in den Jahren 1920 bis 1940 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum
Bau der Berliner Mauer eine Drehscheibe in der Zitherwelt. Fast alle führenden Zithersolisten wie
Wilhelm Otto Mickenschreiber, Ferdinand Kollmaneck, Otto Blasius, Ernst Rommel, Fred Rüffer, Josef Haustein,
Wilhelm Tafelmayer, Max Schulz, Max Albert, Emil Holz, Ewald Kuchenbuch und der langjährige Vorsitzende des
Zentralverbandes Deutscher Zithervereine, Albert Bernet (um nur einige zu nennen), gingen in dieser Werkstätte
ein und aus oder standen mit Adolf Meinel senior und junior in brieflichem Gedankenaustausch. Die noch vorhandenen
Briefwechsel geben uns heute einen Einblick in die damals bereits vorhandene intensive Zusammenarbeit von Zitherbauer
und Zitherspielern. Die schriftlichen Kontakte mit den Zitherspielern pflegte der damalige Adolf Meinel junior über
einen sehr langen Zeitraum bis in die 90er Jahre hinein und nicht selten schrieb er bis zu 15 Briefe an einem Tag, und
das natürlich mit der Schreibmaschine. Obwohl oder gerade weil es den PC noch nicht gab, waren seine Briefe
grundsätzlich fehlerfrei. »Das war immer herrlich, diese persönlichen Verbindungen mit den Musikanten. Aus jedem
Jahr habe ich 10 Ordner mit Briefen. Darin haben wir alles besprochen, und aus jedem leuchtet eine gegenseitige Achtung
heraus«.
Neben seiner Arbeit in der Instrumentenwerkstatt besaß Adolf Meinel nur ein Hobby: das Bergwandern. So wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg u. a. drei Viertausender in der Schweiz bestiegen, selbstverständlich mit einem
Zitherfreund.
Während der schwierigen Zeit des realen Sozialismus in der DDR war ein Güteraustausch mit der Bundesrepublik
Deutschland und anderen Ländern nur über die staatlichen Vertriebswege möglich, sowohl bei den Gitarren als auch bei
den Zithern. Obwohl sich nun der Produktionsschwerpunkt auf die Gitarren verlagerte und Adolf Meinel sich gezwungen sah,
Angestellte zu entlassen, wurden nach wie vor Zithern gebaut. Auch die Instrumente aus dieser Ära wurden stets als
Künstlerinstrumente in bewährter, bester Qualität ausgeliefert.
Obwohl er eigentlich mit 79 Jahren ans Aufhören gedacht hatte, stürzte sich Adolf Meinel nach der
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten noch einmal in die Arbeit und stellte zusammen mit seiner Tochter
Ulrike, die selbst ihren Meisterbrief seit 1982 besitzt, wieder verstärkt Zithern her. Die Übergabe der Werkstatt
erfolgte also über viele Jahre hinweg, die Tradition wurde nahtlos an die nächste Generation weitergegeben. Heute werden
in dieser Werkstatt fast ausschließlich Zithern gefertigt und Reparaturen durchgeführt.
Im Jahre 2004 konnte der Jubilar zusammen mit seiner Frau die Diamantene Hochzeit feiern. Die beiden waren 60
Jahre verheiratet und lebten nach wie vor in der eigenen Wohnung. Adolf Meinel lebte - bis kurz vor seinem Tod - noch
sehr aktiv für sein Alter und vollkommen selbständig, bei geistiger Frische und vollkommener Interessiertheit am
Geschäft und am Weltgeschehen. Er löste weiterhin seine Kreuzworträtsel und machte seinen täglichen Rundgang durch die
Stadt; seine Energie beispielgebend, auch für seine vier Enkelkinder.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Adolf Meinel mit seiner Arbeit bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt
hat, seine Instrumente sind auch heute noch beliebt und gesucht. Er hat sich stets für die Weiterentwicklung der Zither,
für die Herstellung bester Zithersaiten und für optimales Bünde-Material eingesetzt.
Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit Adolf Meinel einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die
Geschichte des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste
erworben. Alle, die Adolf Meinel auch persönlich kennengelernt haben, werden sich immer gerne an ihn erinnern.
(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 4/2009,
Zeitschrift des DZB)
Adolf Meinel
Am 25. Mai 2009 verstarb im Alter von fast 99 Jahren einer der bekanntesten Zithernbauer, der Nestor der
Markneukirchener Instrumentenbauer, Adolf Meinel.
Adolf Meinel wurde am 30. Oktober 1910 in Markneukirchen als Sohn von Adolf Friedrich Meinel (1872 1953)
geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit absolviert er zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend erlernte
er in der traditionsreichen elterlichen Instrumentenbauwerkstätte den Beruf des Zitherbauers und legte 1929 die
Gesellenprüfung mit Auszeichnung ab. Im Jahre 1936 bestand er auch die Meisterprüfung als Zupfinstrumentenbauer.
Wahrscheinlich hätte es für Adolf Meinel nie etwas anderes gegeben als diesen Beruf. »Ich war gut in der
Schule, aber ich wollte arbeiten, in der Werkstatt Instrumente bauen. Zitherbauer ist kein Beruf, dazu muss man geboren
sein. In den Instrumenten steckt eine Seele, die man ihnen gibt.« Der Arbeitsalltag des Instrumentenbauers begann
schon früh: Morgens um 4.30 Uhr aufstehen, die Werkstatt heizen, alles für sich und die Gesellen vorbereiten, um
pünktlich um 6.00 Uhr mit der Arbeit beginnen zu können
Adolf Meinel fertigte in dritter Generation des bereits von seinem Großvater im Jahre 1862 gegründeten Betriebes
Zithern und Gitarren, die in der ganzen Welt hohe Anerkennung fanden. In enger Zusammenarbeit mit seinem Vater wurde
die Klangqualität der Meinel-Zithern auf ein außerordentliches Niveau angehoben. Zusätzlich befasste sich Adolf Meinel
aber auch mit der Weiterentwicklung der Saiten. Er erprobte und berechnete die günstigsten physikalischen Zusammenhänge
zwischen der Mensur, der Saitenspannung, dem Saitenkern und der Umspinnung der Saiten, um eine optimale Klangqualität
auch im Bereich der Saiten zu gewährleisten.
In den 30er Jahren interessierte sich Adolf Meinel in besonderem Maße für die Entwicklung der Quint- und
Basszither. Dadurch war es möglich, auch die Zitherspieler wie in einem klassischen Quartett mit Quint-, Diskant-,
Alt- und Basszither gemeinsam musizieren zu lassen. Was nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass Adolf Meinel eine
Zeitlang auch Zither- und Gitarrenunterricht erhalten hat, und zwar von dem Zithervirtuosen Ernst Rommel, Lehrer
für Zither an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar.
Seit etwa 1930 beschäftigte sich Adolf Meinel zunächst mehr aus persönlichen Gründen mit dem Bau von
Gitarren. Daraus entwickelte sich dann ein zweiter Geschäftsbereich. Diese Entwicklung sollte sich später als sehr
nützlich erweisen, half sie doch mit, während der DDR-Zeit den Fortbestand der traditionsreichen
Instrumentenbauwerkstätte zu sichern. Adolf Meinel äußerte sich folgendermaßen dazu: »
ich habe durch den Bau
beider Instrumente Einblicke gewonnen, die ich als Nur-Zitherbauer oder als Nur-Gitarrenbauer niemals hätte erwerben
können
«.
Die Werkstatt Adolf Meinel war besonders in den Jahren 1920 bis 1940 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum
Bau der Berliner Mauer eine Drehscheibe in der Zitherwelt. Fast alle führenden Zithersolisten wie
Wilhelm Otto Mickenschreiber, Ferdinand Kollmaneck, Otto Blasius, Ernst Rommel, Fred Rüffer, Josef Haustein,
Wilhelm Tafelmayer, Max Schulz, Max Albert, Emil Holz, Ewald Kuchenbuch und der langjährige Vorsitzende des
Zentralverbandes Deutscher Zithervereine, Albert Bernet (um nur einige zu nennen), gingen in dieser Werkstätte
ein und aus oder standen mit Adolf Meinel senior und junior in brieflichem Gedankenaustausch. Die noch vorhandenen
Briefwechsel geben uns heute einen Einblick in die damals bereits vorhandene intensive Zusammenarbeit von Zitherbauer
und Zitherspielern. Die schriftlichen Kontakte mit den Zitherspielern pflegte der damalige Adolf Meinel junior über
einen sehr langen Zeitraum bis in die 90er Jahre hinein und nicht selten schrieb er bis zu 15 Briefe an einem Tag, und
das natürlich mit der Schreibmaschine. Obwohl oder gerade weil es den PC noch nicht gab, waren seine Briefe
grundsätzlich fehlerfrei. »Das war immer herrlich, diese persönlichen Verbindungen mit den Musikanten. Aus jedem
Jahr habe ich 10 Ordner mit Briefen. Darin haben wir alles besprochen, und aus jedem leuchtet eine gegenseitige Achtung
heraus«.
Neben seiner Arbeit in der Instrumentenwerkstatt besaß Adolf Meinel nur ein Hobby: das Bergwandern. So wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg u. a. drei Viertausender in der Schweiz bestiegen, selbstverständlich mit einem
Zitherfreund.
Während der schwierigen Zeit des realen Sozialismus in der DDR war ein Güteraustausch mit der Bundesrepublik
Deutschland und anderen Ländern nur über die staatlichen Vertriebswege möglich, sowohl bei den Gitarren als auch bei
den Zithern. Obwohl sich nun der Produktionsschwerpunkt auf die Gitarren verlagerte und Adolf Meinel sich gezwungen sah,
Angestellte zu entlassen, wurden nach wie vor Zithern gebaut. Auch die Instrumente aus dieser Ära wurden stets als
Künstlerinstrumente in bewährter, bester Qualität ausgeliefert.
Obwohl er eigentlich mit 79 Jahren ans Aufhören gedacht hatte, stürzte sich Adolf Meinel nach der
Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten noch einmal in die Arbeit und stellte zusammen mit seiner Tochter
Ulrike, die selbst ihren Meisterbrief seit 1982 besitzt, wieder verstärkt Zithern her. Die Übergabe der Werkstatt
erfolgte also über viele Jahre hinweg, die Tradition wurde nahtlos an die nächste Generation weitergegeben. Heute werden
in dieser Werkstatt fast ausschließlich Zithern gefertigt und Reparaturen durchgeführt.
Im Jahre 2004 konnte der Jubilar zusammen mit seiner Frau die Diamantene Hochzeit feiern. Die beiden waren 60
Jahre verheiratet und lebten nach wie vor in der eigenen Wohnung. Adolf Meinel lebte - bis kurz vor seinem Tod - noch
sehr aktiv für sein Alter und vollkommen selbständig, bei geistiger Frische und vollkommener Interessiertheit am
Geschäft und am Weltgeschehen. Er löste weiterhin seine Kreuzworträtsel und machte seinen täglichen Rundgang durch die
Stadt; seine Energie beispielgebend, auch für seine vier Enkelkinder.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Adolf Meinel mit seiner Arbeit bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt
hat, seine Instrumente sind auch heute noch beliebt und gesucht. Er hat sich stets für die Weiterentwicklung der Zither,
für die Herstellung bester Zithersaiten und für optimales Bünde-Material eingesetzt.
Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit Adolf Meinel einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die
Geschichte des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste
erworben. Alle, die Adolf Meinel auch persönlich kennengelernt haben, werden sich immer gerne an ihn erinnern.
(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 4/2009,
Zeitschrift des DZB)
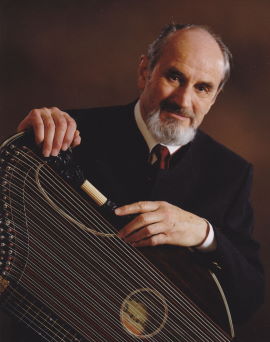 Manfred Schuler
Manfred Schuler Ernst Volkmann
Am 6. Oktober 2009 starb im Alter von 88 Jahren in Ingolstadt einer der bekanntesten Zitherbauer,
Ernst Volkmann.
Ernst Volkmann wurde am 22. Juni 1921 in Schönbach (Böhmen) als Sohn von Hans Volkmann
(»Leopoldnhans«) geboren. Er besuchte 5 Jahre lang die Volksschule, danach 3 Jahre die Bürgerschule in
Schönbach. Von 1935 bis 1938 absolvierte er eine Lehrzeit als Geigenbauer, anschließend arbeitete er ein Jahr als
Geselle in der Werkstatt seines Vaters.
Am 2. Oktober 1939 wurde er zum Wehrdienst in die Luftwaffe einberufen. Von November 1940 an war er
Flugzeugführer, hauptsächlich auf Stukas, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Vor der kurzen
Gefangenschaft bei den Amerikanern flog Ernst Volkmann einmal mit seiner Maschine bis nach Schönbach und landete dort.
Anschließend wurde er zum Arbeitsdienst bei den Tschechen einberufen und arbeitete dort bis zur Vertreibung
am 17. August 1946.
In Ingolstadt fand er mit seiner Familie eine neue Heimat. Zunächst arbeitete er mit seinem Vater bei
Vinzenz Jung in Langquaid als Geselle für Reparaturen. Im August 1947 eröffnete sein Vater Hans Volkmann in
Ingolstadt, Griesmühlstr. 12, wieder eine eigene Werkstatt, damals die einzige zwischen München und Nürnberg sowie
Regensburg und Donauwörth. Der Bedarf an Reparaturen und neuen Instrumenten für Theater und Kammerorchester, für
Gymnasien und Realschulen war sehr groß. Im Januar 1948 trat auch Ernst Volkmann wieder in die Werkstatt seines Vaters
ein. Durch viele Reparaturen an alten Instrumenten kam er schließlich zum Zitherbau. 1953 machte er sich selbstständig
und mietete in der Remise 38 in Ingolstadt eine größere Werkstatt, in der dann auch sein Vater mitarbeitete.
Die Firma Ernst Volkmann wurde schnell bekannt. Es wurden alle Arten von Zithern in dieser Werkstatt hergestellt.
Auch ausländische Kunden wurden beliefert, z.B. aus Österreich, der Schweiz, Holland, Italien, aus den USA, aus
Neuseeland und Japan.
Zum größten Erfolg wurde 1969 die Entwicklung der Zither in Psalterform. So kam Ende der 1950er Jahre
Richard Grünwald bei einem Besuch in Ingolstadt in die Zitherbauwerkstatt von Ernst Volkmann. Dieser fragte
Grünwald: »Wieso lehnen Sie die Basszither so entschieden ab, da wir doch im klassischen Zitherquartett, ähnlich
wie im Streichquartett, ein Bassfundament brauchen?« Lapidar erwiderte Grünwald, dass alle Instrumente, die tiefer
als die Altzither sind, doch keinen befriedigenden Ton hergäben. Doch Ernst Volkmann machte sich daran, trotz der
Skepsis von Richard Grünwald eine eigene Basszither zu entwickeln.
Die intensive Beschäftigung mit theoretischen Ausarbeitungen über den Kontrabass führte ihn schließlich zu der
Erkenntnis, dass zur Erzeugung tieferer Töne die Mensuren und Saitenlängen deutlich länger und die Saiten selbst mehr
Masse bekommen müssten. Dass der neu entwickelten Basszither wegen ihrer neu entwickelten Form und ihrer Größe anfangs
noch mit Skepsis begegnet wurde, war nicht verwunderlich, doch der warme Ton fand schließlich Anerkennung und Bewunderung.
Der Komponist Alfred von Beckerath war vom Klang der neuen Volkmannschen Basszither so angetan, dass er spontan
für Fritz Wilhelm, der Volkmann bei der Entwicklung des neuen Instrumentes in jeder Weise unterstützt hatte, eine
Suite komponierte. Diese wurde 1974 von Fritz Wilhelm im Beisein des Komponisten in einem Jubiläumskonzert für
Alfred von Beckerath in Ingolstadt-Mailing uraufgeführt.
War es zunächst nur die Absicht Volkmanns, durch die Entwicklung der Psalterform die Basszither zu verbessern, so
wurde er schließlich von Zitherspielern bedrängt, insbesondere auch von Fritz Wilhelm, diesen neuartigen Resonanzkörper
auch beim Bau der Alt- und Diskantzither anzuwenden. Die erste Altzither in Psalterform wurde 1974 fertiggestellt und
von Fritz Wilhelm erstmals bei einem Solistenkonzert im Schubertsaal in Wien der Öffentlichkeit präsentiert.
Dr. Knotzinger, ein Vertreter der Wiener Besaitungsart, urteilte damals nach dem Konzert begeistert: »Diese
Altzither ersetzt im Klangvolumen zwei gute Gitarren!« Ein komplettes Zitherquartett in Psalterform wurde dann
erstmals 1981 bei den Zithermusiktagen in Stuttgart vorgestellt. Es fand viel anerkennende Beachtung und mancher
Skeptiker ließ sich überzeugen.
Im Dezember 1983 wurde die Arbeit Ernst Volkmanns jäh unterbrochen. Die Folgen einer zunächst nicht so schwierig
eingeschätzten Kropfoperation, ein Schlaganfall und eine Lungenembolie hielten ihn wochenlang auf der Intensivstation
fest, wobei die Aussicht auf Genesung zunächst sehr gering war. Erst nach einem halben Jahr hatte er sich so weit
erholt, dass er langsam seine Arbeit wieder aufnehmen konnte.
Schon bei den Zithermusiktagen 1984 in Regensburg stellte er eine neue Generation des Zitherquartetts in
Psalterform vor, wobei jedes Instrument auf einem eigenen Resonanztisch stand, der nach den Prinzipien eines Instruments
als eigener Resonanzkörper gebaut worden war.
Die größte offizielle Anerkennung seiner Entwicklungsarbeit erntete Ernst Volkmann, als ihm anlässlich der
Musikmesse in Frankfurt/Main der »Deutsche Musikinstrumentenpreis 1993« zuerkannt wurde. Die Tests hierzu
waren von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig durchgeführt worden. Von 100 möglichen Punkten
erhielt seine Zither in Psalterform 96 Punkte. In den Kategorien Klangfarbe, Klangfülle, Dynamik, Ausgeglichenheit,
Klang der Griffsaiten, Klangreinheit, Spielbarkeit, Bundreinheit, Stimmbarkeit, äußeres Erscheinungsbild, Akzeptanz der
Besonderheiten sowie im Preis-Leistungsverhältnis erzielte seine Psalterzither jeweils den ersten Rang. Noch im
gleichen Jahr wurde seine Zither in Psalterform auch mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.
Aber noch eine weitere Entwicklung von Ernst Volkmann soll erwähnt werden: das Psaltrinchen. Dieses Instrument
mit einem Griffbrett mit 36 cm Saitenmensur lässt einen geringen Saitenzug zu, sodass auch jungen Kindern das mühselige
Drücken auf die Saiten wesentlich erleichtert wird. Ernst Volkmann hat mit seinen Entwicklungsarbeiten, insbesondere
der Psalterzither, bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt hat und die Entwicklung im Instrumentenbau einen bedeutenden
Schritt vorangetrieben.
Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit ihm einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die Geschichte
des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste erworben.
Alle, die das Glück hatten, Ernst Volkmann auch persönlich kennengelernt haben, werden sich mit Sicherheit gerne an ihn
erinnern.
(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 6/2009, Zeitschrift
des DZB)
Ernst Volkmann
Am 6. Oktober 2009 starb im Alter von 88 Jahren in Ingolstadt einer der bekanntesten Zitherbauer,
Ernst Volkmann.
Ernst Volkmann wurde am 22. Juni 1921 in Schönbach (Böhmen) als Sohn von Hans Volkmann
(»Leopoldnhans«) geboren. Er besuchte 5 Jahre lang die Volksschule, danach 3 Jahre die Bürgerschule in
Schönbach. Von 1935 bis 1938 absolvierte er eine Lehrzeit als Geigenbauer, anschließend arbeitete er ein Jahr als
Geselle in der Werkstatt seines Vaters.
Am 2. Oktober 1939 wurde er zum Wehrdienst in die Luftwaffe einberufen. Von November 1940 an war er
Flugzeugführer, hauptsächlich auf Stukas, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Vor der kurzen
Gefangenschaft bei den Amerikanern flog Ernst Volkmann einmal mit seiner Maschine bis nach Schönbach und landete dort.
Anschließend wurde er zum Arbeitsdienst bei den Tschechen einberufen und arbeitete dort bis zur Vertreibung
am 17. August 1946.
In Ingolstadt fand er mit seiner Familie eine neue Heimat. Zunächst arbeitete er mit seinem Vater bei
Vinzenz Jung in Langquaid als Geselle für Reparaturen. Im August 1947 eröffnete sein Vater Hans Volkmann in
Ingolstadt, Griesmühlstr. 12, wieder eine eigene Werkstatt, damals die einzige zwischen München und Nürnberg sowie
Regensburg und Donauwörth. Der Bedarf an Reparaturen und neuen Instrumenten für Theater und Kammerorchester, für
Gymnasien und Realschulen war sehr groß. Im Januar 1948 trat auch Ernst Volkmann wieder in die Werkstatt seines Vaters
ein. Durch viele Reparaturen an alten Instrumenten kam er schließlich zum Zitherbau. 1953 machte er sich selbstständig
und mietete in der Remise 38 in Ingolstadt eine größere Werkstatt, in der dann auch sein Vater mitarbeitete.
Die Firma Ernst Volkmann wurde schnell bekannt. Es wurden alle Arten von Zithern in dieser Werkstatt hergestellt.
Auch ausländische Kunden wurden beliefert, z.B. aus Österreich, der Schweiz, Holland, Italien, aus den USA, aus
Neuseeland und Japan.
Zum größten Erfolg wurde 1969 die Entwicklung der Zither in Psalterform. So kam Ende der 1950er Jahre
Richard Grünwald bei einem Besuch in Ingolstadt in die Zitherbauwerkstatt von Ernst Volkmann. Dieser fragte
Grünwald: »Wieso lehnen Sie die Basszither so entschieden ab, da wir doch im klassischen Zitherquartett, ähnlich
wie im Streichquartett, ein Bassfundament brauchen?« Lapidar erwiderte Grünwald, dass alle Instrumente, die tiefer
als die Altzither sind, doch keinen befriedigenden Ton hergäben. Doch Ernst Volkmann machte sich daran, trotz der
Skepsis von Richard Grünwald eine eigene Basszither zu entwickeln.
Die intensive Beschäftigung mit theoretischen Ausarbeitungen über den Kontrabass führte ihn schließlich zu der
Erkenntnis, dass zur Erzeugung tieferer Töne die Mensuren und Saitenlängen deutlich länger und die Saiten selbst mehr
Masse bekommen müssten. Dass der neu entwickelten Basszither wegen ihrer neu entwickelten Form und ihrer Größe anfangs
noch mit Skepsis begegnet wurde, war nicht verwunderlich, doch der warme Ton fand schließlich Anerkennung und Bewunderung.
Der Komponist Alfred von Beckerath war vom Klang der neuen Volkmannschen Basszither so angetan, dass er spontan
für Fritz Wilhelm, der Volkmann bei der Entwicklung des neuen Instrumentes in jeder Weise unterstützt hatte, eine
Suite komponierte. Diese wurde 1974 von Fritz Wilhelm im Beisein des Komponisten in einem Jubiläumskonzert für
Alfred von Beckerath in Ingolstadt-Mailing uraufgeführt.
War es zunächst nur die Absicht Volkmanns, durch die Entwicklung der Psalterform die Basszither zu verbessern, so
wurde er schließlich von Zitherspielern bedrängt, insbesondere auch von Fritz Wilhelm, diesen neuartigen Resonanzkörper
auch beim Bau der Alt- und Diskantzither anzuwenden. Die erste Altzither in Psalterform wurde 1974 fertiggestellt und
von Fritz Wilhelm erstmals bei einem Solistenkonzert im Schubertsaal in Wien der Öffentlichkeit präsentiert.
Dr. Knotzinger, ein Vertreter der Wiener Besaitungsart, urteilte damals nach dem Konzert begeistert: »Diese
Altzither ersetzt im Klangvolumen zwei gute Gitarren!« Ein komplettes Zitherquartett in Psalterform wurde dann
erstmals 1981 bei den Zithermusiktagen in Stuttgart vorgestellt. Es fand viel anerkennende Beachtung und mancher
Skeptiker ließ sich überzeugen.
Im Dezember 1983 wurde die Arbeit Ernst Volkmanns jäh unterbrochen. Die Folgen einer zunächst nicht so schwierig
eingeschätzten Kropfoperation, ein Schlaganfall und eine Lungenembolie hielten ihn wochenlang auf der Intensivstation
fest, wobei die Aussicht auf Genesung zunächst sehr gering war. Erst nach einem halben Jahr hatte er sich so weit
erholt, dass er langsam seine Arbeit wieder aufnehmen konnte.
Schon bei den Zithermusiktagen 1984 in Regensburg stellte er eine neue Generation des Zitherquartetts in
Psalterform vor, wobei jedes Instrument auf einem eigenen Resonanztisch stand, der nach den Prinzipien eines Instruments
als eigener Resonanzkörper gebaut worden war.
Die größte offizielle Anerkennung seiner Entwicklungsarbeit erntete Ernst Volkmann, als ihm anlässlich der
Musikmesse in Frankfurt/Main der »Deutsche Musikinstrumentenpreis 1993« zuerkannt wurde. Die Tests hierzu
waren von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig durchgeführt worden. Von 100 möglichen Punkten
erhielt seine Zither in Psalterform 96 Punkte. In den Kategorien Klangfarbe, Klangfülle, Dynamik, Ausgeglichenheit,
Klang der Griffsaiten, Klangreinheit, Spielbarkeit, Bundreinheit, Stimmbarkeit, äußeres Erscheinungsbild, Akzeptanz der
Besonderheiten sowie im Preis-Leistungsverhältnis erzielte seine Psalterzither jeweils den ersten Rang. Noch im
gleichen Jahr wurde seine Zither in Psalterform auch mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.
Aber noch eine weitere Entwicklung von Ernst Volkmann soll erwähnt werden: das Psaltrinchen. Dieses Instrument
mit einem Griffbrett mit 36 cm Saitenmensur lässt einen geringen Saitenzug zu, sodass auch jungen Kindern das mühselige
Drücken auf die Saiten wesentlich erleichtert wird. Ernst Volkmann hat mit seinen Entwicklungsarbeiten, insbesondere
der Psalterzither, bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt hat und die Entwicklung im Instrumentenbau einen bedeutenden
Schritt vorangetrieben.
Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit ihm einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die Geschichte
des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste erworben.
Alle, die das Glück hatten, Ernst Volkmann auch persönlich kennengelernt haben, werden sich mit Sicherheit gerne an ihn
erinnern.
(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 6/2009, Zeitschrift
des DZB)

|  |

| 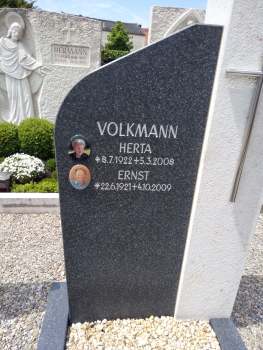 |